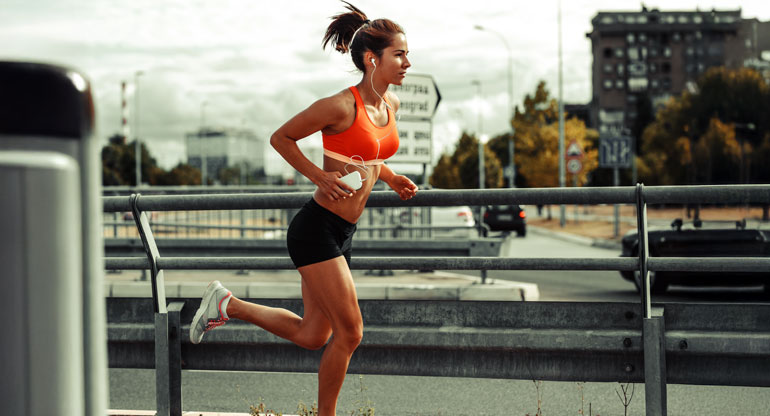Ein Moment, den du kennst: Du läufst, alles fühlt sich rund an – aber du willst mehr. Mehr Tempo. Mehr Effizienz. Der Tempolauf bringt genau das – und zwar ohne dich zu zerschießen.
Was ist ein Tempodauerlauf – und was macht ihn so besonders?
Der Tempodauerlauf – oft einfach nur „Tempolauf“ genannt – ist eine dieser Laufeinheiten, die anfangs unscheinbar wirken, aber langfristig wahre Wunder bewirken. Nicht ganz gemütlich, aber auch kein Sprint: Du läufst
Abgrenzung zu anderen Laufarten
- Lockerer Dauerlauf: gemütliches Grundlagentraining, bei dem du dich noch locker unterhalten kannst. Ideal für Regeneration und Grundlagenausdauer.
- Intervalltraining: kurze, sehr schnelle Belastungen mit Pausen – gedacht für maximale Leistungsspitzen und VO2max-Training.
- Progressive Runs: langsamer Beginn, schneller werdendes Tempo bis ins obere Drittel – eine Art sanfter Übergang ins Tempo.
Der Tempodauerlauf bewegt sich irgendwo dazwischen. Er ist keine Pause, aber auch kein maximaler Sprint. Er ist das Herzstück deiner Tempohärte. Du bleibst durchgehend im oberen Belastungsbereich – am besten im Bereich deiner anaeroben Schwelle. Das bedeutet: Dein Körper kommt gerade noch ohne nennenswerte Laktatübersäuerung klar – aber du spürst ganz genau, dass das hier kein Spaziergang ist.
Kontrolliert schnell – nicht all-out
Wenn du beim Tempolauf nach 5 Minuten das Gefühl hast, aufgeben zu wollen, warst du zu schnell. Wenn du hingegen das Gefühl hast, du könntest ewig so weiterlaufen, warst du zu langsam. Es ist diese feine Balance zwischen „puh, fordernd“ und „ja, das geht noch“, die den Tempodauerlauf so wertvoll macht.
Warum vor allem ambitionierte Hobbyläufer:innen profitieren
Gerade als fortgeschrittene:r Läufer:in bist du irgendwann an einem Punkt, wo gemütliches Traben dich nicht mehr weiterbringt – und hartes Intervalltraining zu viel kaputt macht. Hier setzt der Tempodauerlauf an:
- Er stärkt gezielt deine Schwellenleistung: Du lernst, schneller zu laufen – und das länger durchzuhalten.
- Du verbesserst deine Laufökonomie: Dein Körper wird effizienter darin, Energie bereitzustellen und zu nutzen.
- Du bekommst ein besseres Tempogefühl: Unschätzbar im Wettkampf, vor allem bei 10 km, Halbmarathon oder Marathon.
Viele unterschätzen, wie effektiv dieses Training ist – weil es keine Maximalgeschwindigkeit verlangt. Aber genau das ist der Clou: Du wirst schneller, indem du länger schnell bleibst.
„Viele machen beim Tempodauerlauf den Fehler, im Intervall-Modus zu denken. Es geht um Kontrolle – nicht um Explosion.“
– Dr. Sonja Mühlberg, Sportmedizinerin & Laufcoach
Tempo – aber wie schnell ist schnell genug?
Die häufigste Frage zum Tempodauerlauf lautet: Wie schnell muss ich laufen? Und die ehrlichste Antwort darauf ist: schnell – aber nicht zu schnell. Entscheidend ist, dass du dein persönliches Schwellentempo triffst. Das ist die Geschwindigkeit, bei der dein Körper gerade noch im Gleichgewicht zwischen Sauerstoffaufnahme und Laktatbildung bleibt.
Orientierung am Wettkampftempo
Eine gute Faustregel für den Anfang: Laufe dein Tempo etwa in dem Bereich, den du bei einem 10 km-Rennen oder bei einem ambitionierten Halbmarathon durchhältst. Also: fordernd, aber nicht zerstörend.
- Einsteiger:innen: 15–20 Sekunden pro Kilometer langsamer als 10 km-Renntempo
- Fortgeschrittene: exakt im 10 km-Tempo oder sogar leicht darunter
- Marathonvorbereitung: 10–15 Sekunden schneller als angestrebtes Marathon-Renntempo
Wenn du keine aktuellen Wettkampfzeiten hast, kannst du dich an deinem Gefühl orientieren: Du solltest dich nicht mehr unterhalten können – aber auch nicht nach Luft japsen. Die Belastung ist hoch, aber gleichmäßig. Du „brennst“ nicht – du „glühst“.
Tempoläufe sind kein All-out-Sprint
Der Klassiker: Du startest viel zu schnell – und bist nach 6 Minuten am Ende. Das ist kein Tempodauerlauf, das ist ein gescheitertes Intervall. Tempo muss sich einpendeln. Du darfst ruhig 1–2 Minuten brauchen, um in deinen „Flow“ zu kommen. Danach hältst du das Tempo so stabil wie möglich.
Praxisbeispiel
- Du läufst 10 km in ca. 55 Minuten → Zieltempo Tempodauerlauf: ca. 5:20–5:30 min/km
- Du willst Marathon unter 4 Stunden laufen → Zieltempo Tempodauerlauf: ca. 5:10–5:20 min/km
Diese Zahlen sind natürlich grobe Richtwerte – entscheidend ist, dass du spürst: „Ich laufe an der Kante – aber ich kontrolliere das.“
„Wenn du den Tempolauf wie einen kleinen inneren Wettkampf behandelst – gegen deine Trägheit, gegen dein Ego – dann wirst du jedes Mal stärker rausgehen, als du reingegangen bist.“
– Dr. Sonja Mühlberg
Wie lange sollte ein Tempodauerlauf dauern?
Du weißt jetzt: Tempodauerlauf bedeutet zügiges, kontrolliertes Laufen an der Belastungsgrenze – aber wie lange eigentlich? Die einfache Antwort: zwischen 20 und 40 Minuten im Belastungsbereich. Die etwas differenziertere: Es kommt auf dein Trainingsziel, dein Leistungsniveau und deinen aktuellen Trainingszyklus an.
Die magischen 20 bis 40 Minuten
Warum gerade dieser Bereich? Weil dein Körper ab etwa 20 Minuten richtig gefordert wird, laktattolerant zu bleiben. Ab da beginnt die eigentliche Anpassung. Länger als 40 Minuten im Schwellentempo zu laufen, macht hingegen nur Sinn für sehr erfahrene Läufer:innen – oder in direkter Wettkampfvorbereitung.
Typische Umfänge für Tempodauerläufe
- Einsteiger:innen: 2 km Einlaufen – 15–20 Min Tempolauf – 1 km Auslaufen
- Fortgeschrittene: 2–3 km Einlaufen – 25–35 Min Tempolauf – 2 km Auslaufen
- Marathonvorbereitung: 3 km Einlaufen – 12–15 km im Schwellentempo – 3 km Auslaufen
Das heißt: Ein Tempodauerlauf ist nie nur das Tempo selbst. Die Gesamtlänge der Einheit kann locker bei 10–18 Kilometern liegen, je nach Level. Aber: Der zentrale Trainingsreiz steckt im mittleren Teil – dem kontinuierlichen Tempo-Block.
Warum nicht länger?
Weil du sonst Gefahr läufst, in einen Bereich zu kommen, der dich überfordert statt stärkt. Gerade wenn du zu oft zu lang zu schnell läufst, fällst du in ein chronisches Belastungstief. Besser: kürzer, dafür regelmäßig.
„Die größte Kunst im Training ist es, genau so viel zu tun, dass du wächst – aber nicht verbrennst. Tempoläufe sind wie Chili: Zu viel davon – und dein System rebelliert.“
– Dr. Sonja Mühlberg
Noch ein Hinweis für dein Trainingsprotokoll: Notier dir nicht nur die Dauer, sondern auch dein subjektives Belastungsempfinden (z. B. auf einer Skala von 1–10). So lernst du, besser auf deinen Körper zu hören – und deine Einheiten zu steuern.
Die richtige Herzfrequenz beim Tempolauf
Pace ist gut, aber dein Herz lügt nicht. Die Herzfrequenz ist einer der besten Marker, um zu checken, ob du beim Tempodauerlauf wirklich im richtigen Bereich unterwegs bist – oder ob du heimlich doch wieder einen Ego-Run daraus gemacht hast.
Die Zielzone: Schwelle, Baby, Schwelle!
Beim Tempodauerlauf willst du im Bereich der sogenannten anaeroben Schwelle laufen. Physiologisch bedeutet das: Du produzierst gerade so viel Laktat, wie dein Körper noch verstoffwechseln kann – ohne dass es sich anstaut. Auf den Puls übertragen heißt das:
- 85–90 % deiner maximalen Herzfrequenz (HFmax)
- Oder grob: zwischen 170–180 Schlägen pro Minute, wenn dein HFmax bei 200 liegt
Das fühlt sich nicht locker an – aber du kippst auch nicht ins rote Laktat-Chaos. Du bewegst dich auf einem schmalen Grat zwischen „Ich kann das halten“ und „Länger will ich das nicht“.
Und wenn du deine HFmax nicht kennst?
Dann kannst du sie schätzen – oder besser: selbst bestimmen. Eine einfache (wenn auch knackige) Variante:
- 10 Minuten einlaufen
- 3 Minuten all-out laufen auf der Bahn oder einem leichten Anstieg
- 1 Minute locker traben
- 2 Minuten all-out nachlegen
- Die höchste Herzfrequenz in dieser Phase ≈ deine HFmax
Du kannst auch mit der Faustformel arbeiten: 220 minus Lebensalter – aber Achtung: Das ist sehr ungenau. Lieber auf Nummer sicher gehen und dein individuelles Gefühl in Kombination mit Pulswerteinschätzungen nutzen.
Achte bei deinem nächsten Tempodauerlauf auf deine Herzfrequenz – z. B. mit der Garmin Forerunner 55 Laufuhr:
Was ist wichtiger: Pace oder Puls?
Das hängt vom Ziel ab. Wenn du auf Leistungssteigerung trainierst, ist der Puls entscheidender – weil er zeigt, wie dein Körper auf die Belastung reagiert. Die Pace kann durch Wetter, Tagesform oder Untergrund stark schwanken. Du solltest immer beides im Blick haben, aber:
„Wenn du im Tempodauerlauf auf deinen Puls hörst, hörst du auf deinen Körper. Wenn du nur auf die Uhr schaust, rennst du Gefahr, dich zu verlaufen – und zwar in Richtung Übertraining.“
– Dr. Sonja Mühlberg
Ein kleiner Profi-Tipp zum Schluss: Trainiere bei ähnlicher Temperatur und Tageszeit, wenn du deine Tempoläufe vergleichbar machen willst. Dein Herz schlägt im Sommer schneller als im Frühling – auch wenn du dasselbe läufst.

Zügiger Dauerlauf vs. Tempodauerlauf – wo ist der Unterschied?
Der Übergang ist fließend, und genau deshalb herrscht hier oft Verwirrung. Zügiger Dauerlauf, Tempodauerlauf, Schwellenlauf – klingt alles ähnlich, fühlt sich manchmal auch ähnlich an. Aber: Es gibt feine, entscheidende Unterschiede. Und die beeinflussen, was dein Körper daraus macht.
Definition: Zügiger Dauerlauf
Ein zügiger Dauerlauf ist – wie der Name schon sagt – ein etwas schnellerer, aber kontrollierter Dauerlauf. Du bewegst dich hier meist im Bereich von 75–85 % deiner HFmax, also noch unter der anaeroben Schwelle. Man spricht auch vom „intensiven GA1-Bereich“ (Grundlagenausdauer 1).
Das Tempo: Deutlich über dem lockeren Trab, aber noch komfortabel genug, dass du nicht mit der Uhr feilschen musst. Manche sagen: „Schneller als gemütlich, langsamer als unangenehm.“
Definition: Tempodauerlauf
Der Tempodauerlauf ist dagegen ein echtes Schwellentraining. Du läufst im oberen GA2-Bereich oder sogar schon an der anaeroben Schwelle (85–90 % HFmax). Hier beginnt der Bereich, wo du spürst: „Das hier wird nicht von allein gehen.“
Unterschied in der Wirkung
- Zügiger Dauerlauf: verbessert v. a. deine Fettverbrennung, Laufökonomie und allgemeine Ausdauer
- Tempodauerlauf: erhöht deine Laktattoleranz, deine Geschwindigkeit an der Schwelle und deine mentale Härte
Beides sind super effektive Einheiten – aber mit unterschiedlicher Zielrichtung. Während der zügige Dauerlauf wie ein solides Krafttraining fürs Ausdauersystem ist, wirkt der Tempolauf wie ein spezifisches Feintuning für Wettkampfhärte und Tempokonstanz.
Wann solltest du was machen?
Gute Frage. Hier kommt’s auf dein Ziel an:
- Trainierst du für einen 10-km-Lauf? Dann sind Tempodauerläufe dein bester Freund.
- Bist du im Grundlagenaufbau? Dann lieber häufiger zügige Dauerläufe einbauen.
- Willst du auf Marathon trainieren? Dann brauchst du beides – clever abgestimmt.
„Der Tempodauerlauf bringt dich an deine Grenze – der zügige Dauerlauf bringt dich dahin.“
– Dr. Sonja Mühlberg
Trainingsintegration: Wann, wie oft, wie lange?
Jetzt, wo du weißt, was ein Tempodauerlauf ist, wie schnell und wie lange du ihn laufen solltest, bleibt die entscheidende Frage: Wo passt er in deinen Trainingsplan? Denn so viel ist klar – einfach irgendwo reinschieben funktioniert nicht. Die richtige Einbettung entscheidet darüber, ob du Fortschritte machst oder auf der Stelle trittst.
Bei längeren Tempoläufen sinnvoll: Energie-Gels oder Elektrolytgetränke:
Wie oft pro Woche?
Für die meisten Hobbyläufer:innen reicht ein Tempodauerlauf pro Woche völlig aus. Wenn du sehr ambitioniert unterwegs bist oder auf ein konkretes Ziel wie einen 10 km-Wettkampf oder Halbmarathon trainierst, kannst du auch zwei Einheiten pro Woche einbauen – aber nur mit ausreichend Regeneration dazwischen!
Wann im Wochenverlauf?
Ein klassischer Rhythmus für viele Trainingspläne:
- Dienstag: Tempodauerlauf (nach Ruhetag oder lockerem Wochenstart)
- Donnerstag oder Freitag: lockerer Lauf / Technik
- Sonntag: langer, ruhiger Dauerlauf
Wichtig ist: Zwischen einem harten Tempodauerlauf und dem nächsten fordernden Lauf (z. B. Intervall oder langer Lauf) sollte immer mindestens ein Regenerationstag oder ein leichter Lauf liegen.
Nach intensiven Tempoläufen ist aktive Regeneration Gold wert – z. B. mit einer Massagepistole:
Wie baue ich den Tempodauerlauf in meinen Plan ein?
Das hängt ganz von deinem Laufziel ab:
- Für 5 km- oder 10 km-Rennen: 1–2 Tempodauerläufe pro Woche über 20–30 Minuten, Fokus auf Schwelle
- Für den Halbmarathon: 1 Tempodauerlauf (30–40 Minuten), ggf. mit Progression im letzten Drittel
- Für den Marathon: Kombination aus langen Läufen mit Endbeschleunigung und gezielten Tempoläufen
Trainingsempfehlungen nach Level
- Einsteiger:innen: 1 Tempolauf alle 10 Tage – z. B. 3×8 Minuten mit 2 Minuten Trabpause
- Fortgeschrittene: wöchentlicher Tempodauerlauf über 20–35 Minuten am Stück
- Ambitionierte: Mischung aus Tempodauerläufen und Schwellenintervallen (z. B. 2×15 Min)
„Der Tempodauerlauf ist wie ein Motorcheck in der Woche. Er zeigt dir, wo du stehst – und ob du bereit bist, Gas zu geben.“
– Dr. Sonja Mühlberg
Und keine Sorge: Wenn dir mal die Lust fehlt, ein Tempolauf im Plan steht und der Kopf blockiert – verschieben ist besser als verkümmern. Dein Körper merkt, ob du mit oder gegen ihn trainierst.
Mentale Komponente: Zwischen Komfortzone und Kopfspiel
Es gibt Einheiten, die machen einfach Spaß – Sonne im Gesicht, lockerer Trab, Gedanken schweifen lassen. Und dann gibt es Tempodauerläufe. Die sind wie ein ehrliches Gespräch mit dir selbst: Wie sehr willst du es wirklich?
Beim Tempolauf verlässt du bewusst die Komfortzone. Nicht mit Gewalt, sondern mit Absicht. Du läufst in einem Bereich, der dir sagt: „Ich bin noch da, aber frag mich nicht, wie lange.“ Das ist der Moment, wo mentale Stärke wichtiger wird als Fitness.
Training für den Kopf
Der Tempodauerlauf trainiert nicht nur deine Muskulatur oder dein Herz-Kreislauf-System – er formt dein Mindset. Du lernst, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen: Zweifel, Müdigkeit, monotone Anstrengung. Genau diese Skills brauchst du im Wettkampf, wenn’s richtig hart wird.
Viele scheitern nicht an der physischen Grenze – sondern an ihrem Kopf. Tempodauerläufe bieten dir die Chance, im Training bewusst mit dieser Grenze zu spielen, sie zu verschieben und besser zu verstehen.
Strategien gegen den inneren Widerstand
- Zeit statt Distanz denken: „Nur noch 10 Minuten“, klingt machbarer als „noch 2 Kilometer“
- Abschnittsdenken: Teile den Lauf in Etappen – z. B. 3×10 Minuten statt „30 Minuten am Stück“
- Atmung kontrollieren: Fokussierte Nasenatmung oder bewusstes Ausatmen hilft, Stress rauszunehmen
- Mentale Mantras: Wiederhole kraftvolle Sätze („Ich kann das“, „Locker stark“) in kritischen Phasen
„Wenn du lernst, im Training mit Disziplin durchzuziehen, wirst du im Wettkampf mit Vertrauen belohnt.“
– Dr. Sonja Mühlberg
Und das Beste? Dieses Gefühl nach einem gelungenen Tempodauerlauf ist unvergleichlich. Nicht, weil du so schnell warst. Sondern weil du durchgezogen hast – gegen deine Zweifel, gegen dein altes Ich, gegen dein bequemes Gehirn.
Fazit: Tempo mit System – nicht mit Gewalt
Ein Tempodauerlauf ist kein Sprint und kein Kuschelkurs – sondern ein ehrlicher Dialog zwischen Körper und Kopf. Du trainierst kontrollierte Intensität, mentale Stabilität und länger durchhaltbare Geschwindigkeit. Es ist das Training, das dich nicht nur schneller, sondern intelligenter macht.
Wenn du Tempoläufe klug in deinen Plan einbaust, regelmäßig aber nicht inflationär einsetzt und dich selbst dabei beobachtest, wirst du in wenigen Wochen merken: Du wirst konstanter, stärker, souveräner. Nicht nur im Lauf – sondern auch im Kopf.
Typische Fehler – und wie du sie vermeidest
- Zu schnell loslaufen: Tempodauerlauf ≠ Sprint. Finde dein Schwellentempo – nicht dein Limit.
- Kein Warm-up: Starte nie kalt in einen Tempolauf. 2–3 Kilometer Einlaufen sind Pflicht.
- Zu selten im Plan: Ein Tempolauf alle zwei Wochen bringt wenig – bleib konstant dran.
- Pace über alles: Richte dich nicht nur nach der Uhr. Dein Körpergefühl ist oft der bessere Kompass.
- Keine Regeneration: Tempoläufe brauchen Ruhe danach. Wer direkt weiterballert, riskiert Überlastung.
„Tempodauerläufe zeigen dir, was du draufhast – aber auch, wo du noch wachsen darfst. Sie sind nicht das Ziel – sie sind der Weg dorthin.“
– Dr. Sonja Mühlberg
Also: Schuhe schnüren, Uhr starten, Puls spüren – und los. Nicht volle Kanne, sondern volle Kontrolle. Der Tempodauerlauf wartet nicht. Aber er wird dich belohnen.
Häufige Fragen zum Tempodauerlauf
Was ist ein Tempodauerlauf?
Ein Tempodauerlauf ist ein zügiger, kontinuierlicher Lauf im Bereich der anaeroben Schwelle. Du läufst schnell, aber kontrolliert – nicht all-out. Ideal, um deine Tempohärte und Laufökonomie zu verbessern.
Wie schnell sollte ein Tempodauerlauf sein?
Richtwert: 85–90 % deiner maximalen Leistungsfähigkeit oder ungefähr dein 10-km-Renntempo. Wichtig ist, dass du das Tempo über längere Zeit konstant halten kannst, ohne zu überpacen.
Wie lange dauert ein Tempodauerlauf?
Im Belastungsbereich solltest du 20 bis 40 Minuten einplanen. Plus Ein- und Auslaufen ergibt das meist eine Einheit von 8 bis 16 Kilometern Gesamtumfang.
Welche Herzfrequenz ist beim Tempolauf ideal?
Du solltest im Bereich von 85–90 % deiner maximalen Herzfrequenz unterwegs sein. Das entspricht deinem Schwellentempo, wo der Körper noch mit dem entstehenden Laktat klarkommt.
Was ist der Unterschied zwischen zügigem Dauerlauf und Tempodauerlauf?
Ein zügiger Dauerlauf ist moderat intensiv (75–85 % HFmax), der Tempodauerlauf hingegen deutlich intensiver (85–90 % HFmax) und näher an der anaeroben Schwelle. Beide haben ihren Platz im Trainingsplan.
Wie oft sollte ich einen Tempodauerlauf machen?
Einmal pro Woche reicht für die meisten Läufer:innen. Fortgeschrittene können zwei Einheiten integrieren – mit ausreichend Regeneration dazwischen.
Fotos: BalanceFormCreative / stock.adobe.com
Amazon: Affiliate-Link - mehr Infos / Letzte Aktualisierung am 15.02.2026 / Bilder der Amazon Product Advertising API